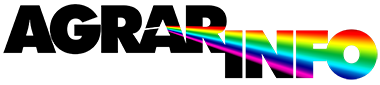Gerne teilen wir hier mit freundlicher Genehmigung des Autors einen Artikel, der in der Zeitschrift Kultur und Politik 2/2013 vom Bioforum Schweiz erschienen ist:
Der Ethiker und ehemalige Landwirt Thomas Gröbly erläutert, warum Ernährungssouveränität mehr als Ernährungssicherheit und lokale Selbstversorgung ist. Eine Gleichsetzung verkürze das von La Via Campesina entwickelt Konzept der Ernährungssouveränität und beraube es seiner „kritisch-explosiven Kraft“.
Ernährungssouveränität:
mehr als lokale Selbstversorgung
 Worte sind frei wie der Geist, und wer die grösste Definitionsmacht hat, kann die Bedeutung von Begriffen festlegen. So entstehen Missverständnisse, aber auch bewusste Manipulationen. Sprache und Begriffe dienen nicht mehr der Vermittlung und dem gegenseitigen Verstehen, sondern werden zu einem Instrument, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Wir alle kennen das Plastikwort „Nachhaltigkeit“. Die nicht auf kurzfristige Gewinne ausgelegte Finanzanlage oder die Fernreise mit CO2-Kompensation gelten heute als „nachhaltig“. Es geht hier wohl eher um eine Verschleierung von Tatsachen und um die Beruhigung des Gewissens, als um den sinnvollen und reflektierten Gebrauch eines Begriffes und Konzeptes. Einige Zeitgenossen verzichten daher bewusst auf den Begriff „Nachhaltigkeit“, obwohl er unbequem radikal wäre: Nicht mehr Bäume aus dem Wald holen, als nachwachsen.
Worte sind frei wie der Geist, und wer die grösste Definitionsmacht hat, kann die Bedeutung von Begriffen festlegen. So entstehen Missverständnisse, aber auch bewusste Manipulationen. Sprache und Begriffe dienen nicht mehr der Vermittlung und dem gegenseitigen Verstehen, sondern werden zu einem Instrument, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Wir alle kennen das Plastikwort „Nachhaltigkeit“. Die nicht auf kurzfristige Gewinne ausgelegte Finanzanlage oder die Fernreise mit CO2-Kompensation gelten heute als „nachhaltig“. Es geht hier wohl eher um eine Verschleierung von Tatsachen und um die Beruhigung des Gewissens, als um den sinnvollen und reflektierten Gebrauch eines Begriffes und Konzeptes. Einige Zeitgenossen verzichten daher bewusst auf den Begriff „Nachhaltigkeit“, obwohl er unbequem radikal wäre: Nicht mehr Bäume aus dem Wald holen, als nachwachsen.
Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität
Ähnlich ergeht es dem Begriff „Ernährungssouveränität“. Wobei hier die Situation komplexer ist. Die seriöse Neue Zürcher Zeitung tat den Begriff vor ein paar Jahren nonchalent ab: Die lokale Selbstversorgung sei für die Schweiz bei einem Selbstversorgungsgrad von 50% unmöglich. Also müssen wir uns keine weiteren Gedanken zum Konzept machen. Der SVP-Präsident und Bauer Toni Brunner hält am Begriff fest und kritisierte kürzlich in einem Referat in Ebnat Kappel die Agrarpolitik 2014/2017 als „eine Vorlage, die die Nahrungsmittelproduktion und damit die Ernährungssouveränität in unserem Land abbaut und stattdessen auf noch mehr Ökologie und Extensivierung setzt“. In beiden Beispielen wird die lokale Lebensmittelproduktion verkürzt mit Ernährungssouveränität gleichgesetzt. Das ist nicht ganz falsch, aber eben auch nicht ganz richtig.
 Wenn ich von „richtig“ spreche, dann nehme ich Bezug auf das Konzept, das von La Via Campesina im Jahr 1996 als Antwort auf die WTO-Politik des globalen Agrarfreihandels entwickelt wurde: „Ernährungssouveränität bezeichnet das Recht der Bevölkerung, eines Landes oder einer Union, die Landwirtschafts- und Verbraucherpolitik ohne Preis-Dumping gegenüber anderen Ländern selbst zu bestimmen. Das Konzept geht vom Vorrang der regionalen und nationalen Selbstversorgung aus. ProduzentInnen, VerarbeiterInnen und VerbraucherInnen verpflichten sich zu transparenter Deklaration und kostendeckenden Preisen, damit die BäuerInnen nachhaltig produzieren können.“ Gemäss dem Konzept von La Via Campesina ist Ernährungssouveränität also weit mehr als die nationale Selbstversorgung.
Wenn ich von „richtig“ spreche, dann nehme ich Bezug auf das Konzept, das von La Via Campesina im Jahr 1996 als Antwort auf die WTO-Politik des globalen Agrarfreihandels entwickelt wurde: „Ernährungssouveränität bezeichnet das Recht der Bevölkerung, eines Landes oder einer Union, die Landwirtschafts- und Verbraucherpolitik ohne Preis-Dumping gegenüber anderen Ländern selbst zu bestimmen. Das Konzept geht vom Vorrang der regionalen und nationalen Selbstversorgung aus. ProduzentInnen, VerarbeiterInnen und VerbraucherInnen verpflichten sich zu transparenter Deklaration und kostendeckenden Preisen, damit die BäuerInnen nachhaltig produzieren können.“ Gemäss dem Konzept von La Via Campesina ist Ernährungssouveränität also weit mehr als die nationale Selbstversorgung.
Warum ist vor allem die verkürzte Auslegungen, also „Ernährungssouveränität“ als Ernährungssicherheit, in aller Munde? Darüber kann ich nur spekulieren. Es könnte an einer mangelnden Auseinandersetzung mit der Herkunft des Konzepts liegen: Was geht mich ein Konzept an, das nicht aus den Machtzentren der Welt kommt, sondern von einer bäuerlichen Organisation aus dem Süden? Es könnte auch sein, dass der Begriff sich bestens dafür anbietet, die eigenen nationalen Interessen mit einem globalen Solidaritätsanstrich zu versehen. Ebenfalls möglich ist, dass der Begriff an sich Verwirrung stiftet. Er ist für unsere Ohren irritierend und für unsere Zungen keine Wohltat. Was heisst „Souveränität“? Das heisst doch, dass ich selber darüber bestimmen kann, was mich betrifft. In Bezug auf die Lebensmittel ist die Idee aber zu relativieren. Kein Mensch hat je eine Pflanze zum Wachsen gebracht. Wir sind vom Boden, vom Wasser, von der Fruchtbarkeit und vom Wachstum abhängig. Es gibt also keine absolute Souveränität des Menschen. Unsere Freiheit und Selbstbestimmung ist an die Biologie, an die Kreisläufe von Werden und Vergehen gebunden.
Durch die Brille der eigenen Überzeugungen kann jemand zu einem ganz anderen Verständnis von Ernährungssouveränität kommen. Wer glaubt, dass Agrarfreihandel und internationaler Wettbewerb die BäuerInnen von ihren marktwirtschaftlichen Hemmschuhen „befreien“ und sie zu effizienten „UnternehmerInnen“ machen kann, wird das Konzept der Ernährungssouveränität entweder ablehnen oder grundlegend umdeuten, im Sinne von: Nur eine Industrialisierung von Landwirtschaft, Verarbeitung und Vermarktung können angesichts der Knappheit an Boden, Düngern und Wasser eine effiziente Versorgung mit Nahrungsmitteln garantieren. Wer fest in diesem industriellen Denkgebäude verankert ist, kann mit dem „richtigen“ Konzept der Ernährungssouveränität nichts anfangen, denn es bedeutete Sand im Getriebe.
Beteiligt statt abhängig sein
Ernährungssicherheit kann auch im Widerspruch zur Idee der Ernährungssouveränität stehen. Ernährungssicherheit, so wichtig sie auch ist, nimmt kaum auf den sozialen und den ökologischen Kontext Rücksicht, sondern legt den Fokus vorwiegend auf eine ausreichende Produktion von sicheren Lebensmitteln. Wer über Boden, Wasser und Saatgut verfügt, ist dabei nebensächlich. Spätestens seit dem Weltagrarbericht 2008 ist dieser Ansatz als ungenügend taxiert worden.
 Ulrike Minkner, Co-Präsidentin von Uniterre, setzt die neue Broschüre „Für eine Ernährung mit Zukunft – Souveränität auf Acker und Teller“ (siehe Kasten am Ende dieses Artikels) bewusst in Bezug zum Weltagrarbericht, worin der Zusammenhang zwischen Armut und Hunger aufgezeigt werde: „[D]ie reine Kalorienmenge verliert dabei an Bedeutung. Eingefordert werden die ökologische Produktionsweise, der Zugang zu Boden, Wasser und Saatgut, die Förderung der Frauen, sowie Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Das Recht auf Nahrung als Menschenrecht hat absoluten Vorrang. Als logische Konsequenz wird das Konzept der Ernährungssouveränität präsentiert.“ Damit wird auch dem industriellen Verständnis von Landwirtschaft eine Absage erteilt, denn hier gilt die demokratische Mitbestimmung der BäuerInnen und der Essenden als ein Störelement. In seinem Beitrag zur Broschüre beklagt der ehemalige PDA-Nationalrat Josef Zisyadis den Graben, den die multinationale Nahrungsmittelindustrie zwischen den kleinen ProduzentInnen und den KonsumentInnen geschaffen hat. „Unser Widerstand muss sich in kurzen, regionalen Wertschöpfungsketten konkretisieren.“
Ulrike Minkner, Co-Präsidentin von Uniterre, setzt die neue Broschüre „Für eine Ernährung mit Zukunft – Souveränität auf Acker und Teller“ (siehe Kasten am Ende dieses Artikels) bewusst in Bezug zum Weltagrarbericht, worin der Zusammenhang zwischen Armut und Hunger aufgezeigt werde: „[D]ie reine Kalorienmenge verliert dabei an Bedeutung. Eingefordert werden die ökologische Produktionsweise, der Zugang zu Boden, Wasser und Saatgut, die Förderung der Frauen, sowie Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Das Recht auf Nahrung als Menschenrecht hat absoluten Vorrang. Als logische Konsequenz wird das Konzept der Ernährungssouveränität präsentiert.“ Damit wird auch dem industriellen Verständnis von Landwirtschaft eine Absage erteilt, denn hier gilt die demokratische Mitbestimmung der BäuerInnen und der Essenden als ein Störelement. In seinem Beitrag zur Broschüre beklagt der ehemalige PDA-Nationalrat Josef Zisyadis den Graben, den die multinationale Nahrungsmittelindustrie zwischen den kleinen ProduzentInnen und den KonsumentInnen geschaffen hat. „Unser Widerstand muss sich in kurzen, regionalen Wertschöpfungsketten konkretisieren.“
Letztlich geht es beim Konzept der Ernährungssouveränität um die demokratische Mitbestimmung im gesamten Ernährungssystem. Die Abhängigkeiten von Systemen, die wir nicht mitgestalten können, soll verringert werden. Ernährungssouveränität stellt allerdings nicht alles zur Disposition. Die nachhaltige Produktion, faire Preise für alle, das Dumping-Verbot und die transparente Deklaration sind die ernährungssouveränen Grundvoraussetzungen und setzen den Rahmen der demokratischen Mitbestimmung.
Haben wir heute schon Ernährungssouveränität?
Die Schweizer Agrarallianz, ein Zusammenschluss von Organisationen aus den Bereichen Landwirtschaft, Konsumenten-, Tier- und Umweltschutz, steht grundsätzlich für das Konzept der Ernährungssouveränität ein und sieht es in der Schweiz als bereits weitgehend umgesetzt an. Die Agrarallianz erachtet daher eine Verfassungsänderung als unnötig: Die Schweizer Agrarpolitik werde bereits heute im Sinne des Konzeptes demokratisch ausgehandelt. Zudem sei die „Qualitätsstrategie“ – das Bestehen auf einem liberalisierten Markt mittels qualitativer Abhebung von der Massenproduktion – eine gute Antwort auf den Agrarfreihandel, welcher auch als (Export-)Chance gesehen wird. Der Begriff „Ernährungssouveränität“ wird mittlerweile auch von allen politischen Parteien gebraucht, meist jedoch nicht im Sinne von La Via Campesina. Das widerspiegelt sich im neuen Landwirtschaftsgesetz, in den der Begriff Eingang gefunden hat. Artikel 2 abs. 4 besagt: „Die Massnahmen des Bundes orientieren sich am Grundsatz der Ernährungssouveränität zur Berücksichtigung der Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten nach qualitativ hochwertigen, vielfältigen und nachhaltigen inländischen Produkten.“
 Der grüne Nationalrat Balthasar Glättli nennt das einen „amputierten Begriff“, bei welchem die „kritisch-explosive Kraft“ gebannt wurde. Die Verkürzung auf das Inland haben alle bürgerlichen Parteien gegen den Einwand der Linken und der Grünen durchgesetzt. Das widerspricht dem Konzept von La Via Campesina, welches neben dem Vorrang der lokalen Produktion die globale Solidarität und Verantwortung vorsieht und weder Exportsubventionen, noch die Ausbeutung von in- und ausländischen LandarbeiterInnen zulässt. Auch der mächtige Schweizer Bauernverband SBV hat die internationale Solidarität gekippt. Das ist unverständlich, denn heute sind wir für unser alltägliches Essen auf Importe angewiesen. Aber die Garantie, mit Geld immer genügend Lebensmittel auf dem Weltmarkt kaufen zu können, kann uns niemand geben. Solidarische Netze zu knüpfen und demokratisch ein nachhaltiges Ernährungssystem aufzubauen, das weit über die Landwirtschaft hinausgeht, ist vernünftig und notwendig. Wer isst, ist für die Umsetzung dieser Ideen verantwortlich.
Der grüne Nationalrat Balthasar Glättli nennt das einen „amputierten Begriff“, bei welchem die „kritisch-explosive Kraft“ gebannt wurde. Die Verkürzung auf das Inland haben alle bürgerlichen Parteien gegen den Einwand der Linken und der Grünen durchgesetzt. Das widerspricht dem Konzept von La Via Campesina, welches neben dem Vorrang der lokalen Produktion die globale Solidarität und Verantwortung vorsieht und weder Exportsubventionen, noch die Ausbeutung von in- und ausländischen LandarbeiterInnen zulässt. Auch der mächtige Schweizer Bauernverband SBV hat die internationale Solidarität gekippt. Das ist unverständlich, denn heute sind wir für unser alltägliches Essen auf Importe angewiesen. Aber die Garantie, mit Geld immer genügend Lebensmittel auf dem Weltmarkt kaufen zu können, kann uns niemand geben. Solidarische Netze zu knüpfen und demokratisch ein nachhaltiges Ernährungssystem aufzubauen, das weit über die Landwirtschaft hinausgeht, ist vernünftig und notwendig. Wer isst, ist für die Umsetzung dieser Ideen verantwortlich.