Hans Bieri, SVIL, reagiert auf den Artikel von Markus Schär, ‚Die Mythenbauern’, erschienen in Die Weltwoche; 21.11.2013; Ausgabe Nr. 47; Seite 26:
 Markus Schär fragt: „Fürchten sich die Schweizer vor dem Hungertod?“ Wegen der Hungerkrise 1918 wurde in den Schweizer Städten geschossen und es gab Tote. Es genügen bereits leere Regale und der Alltag verändert sich in jeder Beziehung. Davon weiss Markus Schär nichts, denn er erliegt selbst dem allergrössten Mythos, dass nämlich die Regale stets automatisch aufgefüllt werden. Schär behauptet, dass die Lebensmittelversorgung durch offene Märkte am besten gewährleiste sei, denn bereits ohne Diesel stünde die Landwirtschaft still, kein Diesel, kein Getreide. Kein Zweifel: Der Handel auf der Basis des gegenseitigen Vorteils schafft Wohlstand. Aber
Markus Schär fragt: „Fürchten sich die Schweizer vor dem Hungertod?“ Wegen der Hungerkrise 1918 wurde in den Schweizer Städten geschossen und es gab Tote. Es genügen bereits leere Regale und der Alltag verändert sich in jeder Beziehung. Davon weiss Markus Schär nichts, denn er erliegt selbst dem allergrössten Mythos, dass nämlich die Regale stets automatisch aufgefüllt werden. Schär behauptet, dass die Lebensmittelversorgung durch offene Märkte am besten gewährleiste sei, denn bereits ohne Diesel stünde die Landwirtschaft still, kein Diesel, kein Getreide. Kein Zweifel: Der Handel auf der Basis des gegenseitigen Vorteils schafft Wohlstand. Aber
Wirtschaften ist nicht nur Handel treiben, sondern Wirtschaften ist Produktion, und Produktion ist Stoffwechsel mit der Naturgrundlage, beginnend mit der Landwirtschaft.
Industrielle Produktion kann an einem Ort konzentriert sein und die ganze Welt versorgen. Hingegen ist die Lebensmittelproduktion an den Boden gebunden, gleichsam an den solargetriebenen Wachstumsprozess der Natur. Die räumliche Konzentration und übermässige Spezialisierung der Lebensmittelproduktion ist deshalb ökonomisch und ökologisch unsinnig. Und weil das eben so ist, widerspricht der Weltagrarbericht den Forderungen der OECD und hält 2009 fest, dass die kleinstrukturierte, bäuerliche Landwirtschaft pro Fläche am meisten Nahrungsmittel erzeugt und am wenigsten mineralische Hilfsstoffe braucht. Sie ist in ihrer Struktur unabhängig und eben „souverän“ von den Krisenbewegungen der globalen Wachstumswirtschaft, welche hauptsächlich auf dem Input von nichterneuerbaren Hilfsstoffen beruht und mit Dumping sich Vorteile erkämpft, die nicht nachhaltig sind. Mit der Verwendung von nichterneuerbaren Hilfsstoffen können lediglich kurzfristig ökonomische Effizienzreserven genutzt werden, welche aber die Fruchtbarkeit der Böden reduzieren und die Landwirtschaft global in einer Art räumlicher Arbeitsteilung nach kolonialem Muster ausrichten wollen. Dadurch wird die Ernährung den Krisenbewegungen der Wachstumsökonomie und des Finanzsektors weltweit zunehmend ausgesetzt. Schär irrt weiter, wenn er meint, diese Zusammenhänge würden nur für die Dritte Welt gelten und es sei trickreicher ideologischer Diebstahl, auch in hochentwickelten Industrieländern Ernährungssicherheit und „Ernährungssouveränität“ zu fordern, wie das aktuell immer mehr Menschen erkennen, die daran interessiert sind, unsere Errungenschaften nicht durch sinnlose Krisen zu verlieren, sondern in die Zukunft gültig weiterzuentwickeln.
Nachfolgend ein paar Informationen zu Handen der Diskussion:
1. Die hohe Kaufkraft der Schweiz gewährt keine Versorgungssicherheit. Beweis: der Generalstreik 1918. Getreide, das die Schweiz gekauft hatte, wurde in Genua konfisziert und in akutere Hungergebiete Osteuropas umgelenkt, wo es bereits massenhaft Hungertote gab. Der Markt ist gerade im bei vital wichtigen Versorgungen und somit nicht freiwählbaren Abhängigkeiten nicht die einzige Instanz.
2. Die Schweiz war anfangs des 20. Jahrhunderts das freihändlerischste Land Europas. Weil das Getreide aus der Ukraine bedeutend billiger war, gab es anfangs des 20. Jahrhunderts praktisch keine Getreideproduktion mehr in der Schweiz. Die völlige Importabhängigkeit der Schweiz war dann die Voraussetzung der Hungerkrise. Dieses Risiko wurde von klugen Leuten übersehen, weil man sich mit der damals schon signifikanten Kaufkraft sicher fühlte.
3. Die Schweiz hat pro Kopf die höchsten Einkommen der Welt. Das ist die Folge davon, dass die Schweiz wirtschaftlich als kleines Land stark mit dem Weltmarkt verflochten ist. Das hohe Niveau der Einkommen bewirkt, dass wir in der Schweiz aber auch ein markant höheres Preisniveau haben. Dieses sogenannte Kostenumfeld bestimmt auch die Höhe der Fremdleistungen, welche die Landwirtschaft, um zu produzieren, beschaffen muss. Bei fünf bis zehnmal höheren Bodenpreisen und Lohnkosten ist die Rechnung schnell gemacht: In der Schweiz Landwirtschaft zu betreiben lohnt sich nicht. Der Import ist wesentlich billiger. Lässt man also nur den Markt entscheiden, heisst das, dass jedes wirtschaftlich hochentwickelte Land, das keine eigenen tiefpreisigen, wenig entwickelte Hinterlandgebiete hat, auf eine eigene Landwirtschaft — ausser ein paar Nischenproduzenten — verzichten muss. Ist das der Sinn des Fortschritts?
4. Aus Sicht der OECD, welche den Auftrag hat, das globale Wirtschaftswachstum voranzutreiben, ist es deshalb Doktrin, dass die Schweiz die Nahrungsmittel importiert. Die durch den Import billiger Nahrungsmittel freigesetzte Kaufkraft soll zusätzliches Wachstum bewirken — um den Preis, dass die Landwirtschaft in der Schweiz aufgegeben wird. Das unterstreichen die OECD-Statistiken zur Schweiz.
5. Bezogen auf die Schweiz stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit wie folgt: Wenn wir also hohe Einkommen haben, dann sollte es doch noch möglich sein, frische Lebensmittel aus dem eigenen Lebens- und Währungsraum zur Verfügung zu haben. Andernfalls müsste man ja sagen, dass der wirtschaftliche Erfolg zwingend zum Verlust der eigenen Landwirtschaft führen muss, was die OECD ja empfiehlt.
Die Wahl zwischen diesen beiden Varianten ist letztlich ein wirtschaftspolitischer Grundsatzentscheid, welcher die gesamte Bevölkerung betrifft.
6. Die Befürworter des Agrarfreihandels erschweren diese Klärung jedoch dadurch, dass sie zwar wirtschaftliches Wachstum durch billigen Nahrungsmittelimport anstreben, diese Absicht jedoch nicht offen kommunizieren. So auch Schär. Er behauptet entgegen den historisch belegten Fakten, der Grenzschutz sei eingeführt worden, um die mangelnde Effizienz der Landwirtschaft im Hochlohnland zu schützen. Die hohen Preise seien die Folge des Grenzschutzes und nicht umgekehrt. Fakt ist aber, dass der Grenzschuz eingeführt wurde, um überhaupt Landwirtschaft in der hochpreiseigen Exportschweiz zur inneren Lebensmittelversorgung betreiben zu können. Das ist der Punkt.
Weiter müssen zwei Probleme auseinanderhalten und nicht vermischt werden: erstens die ökologische Gebundenheit der Landwirtschaft an die Natur, welche die Rationalisierung nach industriellem Muster stark einschränkt. Zweitens, das hohe Kostenumfeld in industriell entwickelten Hochlohnländern überträgt sich zwingend auf die landwirtschaftlichen Produzentenpreise. Hebt man den Grenzschutz auf, ändert sich an den beiden bestimmenden Faktoren nichts und die Landwirtschaft muss rein preislichen Gründen aufgegeben werden.
Indem Schär den Grenzschutz für eine fehlende Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft verantwortlich macht, übergeht er nicht nur die oben dargelegten Zusammenhänge, sondern er schiebt dadurch die Verantwortung für die Folgen der Grenzöffnung der Landwirtschaft direkt in die Schuhe. Es liege folglich an der Landwirtschaft selbst, sich zu behaupten oder dem Import Platz zu machen.
Die tiefen Importpreise, welche die Schweizer Landwirtschaft trotz aller Rationalisierung nie erreichen kann, sind jedoch nicht automatisch ein Zeichen wirtschaftlicher Effizienz — sonst wären ja die armen Länder die ökonomisch effizientesten. Wenn also in der EU, z.B. in Polen, der Milchpreis einen Drittel des schweizerischen Milchpreises ausmacht, jedoch die Löhne und Pachtzinsen in Polen nur einen Zehntel der in der Schweiz geltenden Kosten ausmachen, wer produziert dann die Milch effizienter? Man kann diese Frage nicht einfach unbeantwortet lassen. Dazu kommt, dass die Schweizer Bauern bei der Milchproduktion klar die tiefsten Keimzahlen (Bakterien) haben. Und hätten wir nicht die zwangsweise Grenzöffnung durch das GATT gehabt, wir hätten immer noch einen gesunden Tierbestand wie vor der Agrarreform.
Es macht also keinen Sinn, die Schweizer Milchbauern, welche effizienter und sogar qualitativ besser produzieren, aus dem Markt zu drängen durch billige Importmilch, die weniger effizient hergestellt wurde. Denn dadurch würde die Kaufkraft der polnischen Konsumenten geschwächt, weil sie auf einen Schlag teurere Milch hätten. Und der Schweizer Konsument hätte keine frische und antibiotikafreie Milch mehr aus seiner Umgebung.
7. Aus diesen Gründen macht es sehr wohl Sinn zu fragen, wie viel der Schweizer Konsument und der polnische Konsument für die Ernährung ausgeben. Und wenn es dann so ist, dass der finanziell besser gestellte Schweizer Konsument prozentual deutlich weniger ausgibt für die Ernährung als die Konsumenten in der EU, zeigt das, dass die ökonomische Verhältnismässigkeit — trotz des heute wirksamen Grenzschutzes und der Stützung landwirtschaftlichen Einkommens, voll gewahrt ist.
Fazit
Die Frage ist, wie muss man es machen, eine eigene Landwirtschaft zu halten, wenn in einem wirtschaftlich entwickelten Land wie der Schweiz der Import alleweil billiger ist? Das geht nur mit Grenzschutz zu Gunsten höherer Preise und durch direkt Einkommenstransfers an die Landwirtschaft wie Direktzahlungen durch den Staat.
Dass die Konsumentenpreise der Lebensmittel in der kaufkräftigen Schweiz gegenüber den Preisen, welche die Landwirtschaft noch löst, weiter ansteigen, führt auch zu den Margen der Verarbeiter/Verteiler, welche im Standort Schweiz ebenfalls höhere Kosten zu bewältigen haben. Wie kann die Nahrungsmittelverarbeitungsindustrie sich darin entwickeln? Ist das Wachstum im Export ein Muss? Die Diskussion um die „Swissness“ wird nur zu Ergebnissen führen, wenn die grundlegenden Unterschiede zwischen der Landwirtschaft und der Industrie mit einem zunehmenden Verständnis für die Ökologie, sprich für die Naturgrundlage, besser erkannt und in der Gestaltung der Wirtschaft auch progressiv umgesetzt werden.
Wenn Herr Schär weiss, wie man es anders machen kann, soll er es darlegen. Wir werden gerne wieder Stellung nehmen.
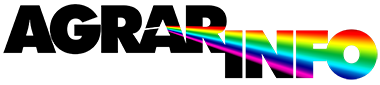

Vielen Dank Herr Bieri für diese gelungene Darstellung einer weitsichtigeren Denkweise. Was mir als “selber Bauer” zu denken gibt, ist die Ansicht von Effizienz. Ok, dass es auf den ersten Blick effizienter scheint, wenn eine landiwirtschaftliche Arbeitskraft 50 ha statt wie in der CH rund 10 ha bewirschaftet (wie Herr Schär in GB angibt).
Es scheint mir schwierig diese Vergleiche, dennoch sehe ich es als effizienter, wenn in der Schweiz sich 5 Arbeitskräfte genüber “nur einer” in GB pro 50 Hektaren entlöhnen lassen. Ganz ähnlich sieht es zwischen Süd- und Norddeutschland aus, und das bei ähnlichen öffentlichen Zahlungssystem.
A ja, und obendrein, Herr Schär, guten Appetit beim Roundup-Ready Gentechnick Brötchen!