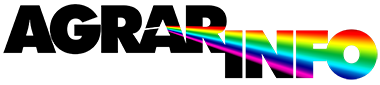Artikel von Thomas Gröbly, erschienen in der “Bäuerlichen Zukunft 329”, Oktober 2013, hier publiziert mit der freundlichen Genehmigung des Autors.
Einsam steht das edle, schwarze Schild, „Siderswil“* in Goldlettern geschrieben, auf dem bescheidenen Dorfplatz. Das stolze Schild wird von liebevoll gepflegten Blumen und Pflastersteinen umrandet. Die Welt ist in Ordnung. In diesem Weiler im Schweizer Mittelland bin ich mit einem Bauernsohn übers Land gegangen. Er hat mir seine Heimat erklärt. Siderswil hat heute 40 Einwohner und davon neun Kinder. Vor 40 Jahren, als mein Freund Kind war, lebten über 100 Menschen im Ort. Heute arbeiten ein Biobauer und ein IPBauer und ein Bauer mit 8.000 Legehennen für die Eierproduktion da. Vor 40 Jahren waren es etwa zehn Bauernhöfe. Die Milch wird von zwei verschiedenen Lastwägen abgeholt und verarbeitet. Biomilch in der Biomolkerei, die IP-Milch an einem anderen Ort. Die Käserei am Dorfrand produziert Appenzeller Käse mit Milch, welche von auswärts ins Dorf gebracht wird. Das Restaurant wurde von einer etwa 80-jährigen Frau geführt, welche vor kurzer Zeit wegen Unfall schließen musste.
Der Besitzer der großen Pferdepension „Horse Joy Farm“* kam hier günstig zu Haus und Hof. Reiter und Pferdebesitzer reisen teilweise aus dem Ausland an. Das Futter wird zugekauft, der Mist wohl auswärts verkauft. Der Eierbauer kauft das Hühnerfutter ebenfalls zu, wahrscheinlich enthält es brasilianisches Soja. Die Eier können unmöglich in der Umgebung verzehrt werden. Die Milchbauern nutzen das Grasland vor Ort (und kaufen wohl auch noch Kraftfutter zu).
Nach den Beschreibungen meines Freundes hat sich die Landschaft seit seiner Kindheit vor 40 Jahren stark verändert. Viele Hochstammbäume wurden gefällt, Gräben zugeschüttet und Hecken ausgerissen. Freie Fahrt für Traktoren. Eine Hochspannungsleitung führt quer übers Land. Für ihn eine ausgeräumte Landschaft und im Vergleich zu früher nicht mehr schön. Wem dieser Vergleich fehlt, der kann heute an der Ruhe und der hügeligen Landschaft Gefallen finden.
Golfplatz statt Dinkel
„Wachsen oder Weichen“ wird technisch Strukturanpassung genannt und führt überall zu ähnlichen Ergebnissen. Das Prinzip ist so selbstverständlich und tief in den „mentalen Infrastrukturen“ eingeprägt, dass wir es als normal anschauen. Die Vorstellung, es könnte anders sein, unmöglich. Straßen, Autos, Traktoren werden größer. Lebensmittel kommen von weit her. Selbst in den Kühlschränken der Bäuerinnen und Bauern findet man mehr fremde als eigene Lebensmittel. Immer weniger Firmen kontrollieren alles rund ums Bauern. „Wachsen oder Weichen“ ist aber ungenau. Dahinter steckt die Idee, der „freie“ Markt und die Geldsphäre würden alles gut regeln. Alles wird zur Ware und nur, wo Profit winkt, wird der „moderne“, „innovative“ und „unternehmerische“ Bauer etwas tun. Das haben wir so weit internalisiert, dass wir es normal finden, einen Hof als Betrieb und den Bauern als Unternehmer zu benennen. Das zinsbasierte Geld erzwingt Wachstum ohne Grenzen. Denkt man in dieser Logik zu Ende, ist die Landwirtschaft bedroht. Mit Pferden, Villen oder Golfplätzen lässt sich pro Hektar mehr erwirtschaften als mit Streuobstwiesen, Kartoffeln oder Dinkel. Was wächst, und was muss weichen?
Bauern und Bäuerin sind Sand im Getriebe
„Wachsen und Weichen“ führt zu mehr Markt, mehr Kapitaleinsatz, mehr Transporten rund um den Globus und mehr globalem Agrarfreihandel. Auf wundersame Art und Weise werden Bohnen aus Kenia und Äpfel aus Chile günstiger als lokale Früchte. Daran verdienen viele, nur die Bäuerinnen und Bauern kaum. Könnte es sein, dass unser ganzes globales Ernährungssystem too big to fail ist? Zu groß, um zu scheitern? Viele Arbeitsplätze, Finanzanlagen und Pensionskassen hängen davon ab, und die Staaten sind gezwungen, dieses sozial und ökologisch widersinnige System mit viel Geld und Gesetzen aufrecht zu erhalten. Die bekannten Geschichten von den Kartoffeln in Holland geerntet, in Ungarn gewaschen, in Italien geschnitten und wieder in Holland gegessen, dienen als Beleg. Das erhöht das Bruttosozialprodukt und das Wachstum, aber letztlich ohne Mehrwert. Zu viele verdienen an der Landwirtschaft und verhindern Schritte zu einem sozial und ökologisch nachhaltigen System. Im Gegenteil.
Die Bäuerinnen und Bauern stehen der optimalen Verwertung des Kapitals im Weg. Was wächst und was weicht? Kartoffeln sollen wachsen, Böden fruchtbarer werden. Mit dem Prinzip „Wachsen und Weichen“ ist etwas anderes gemeint. Deshalb stellt sich die ernsthafte Frage: Was soll wachsen und was weichen? Wege, wenn sie weiterhin vor Ort auf Ackerboden Lebensmittel anbauen wollen. Sie sind zuwenig flexibel und können nicht wie Industriebetriebe sich kurzfristig der Nachfrage anpassen. Sie werden gezwungen, weltweit in Konkurrenz zu treten. Selbst modernste Betriebe müssen schließen, weil sie mit den tiefen Weltmarktpreisen nicht überleben können. Das führt in letzter Konsequenz zur Abschaffung der Landwirtschaft. Der bäuerlichen ganz sicher. Überleben tun nur noch industrialisierte Betriebe, mit standardisierten Nahrungsmitteln ohne Bezug zum Boden, zu den Menschen und zur Ökologie. Lebensmittel werden zu Waren, die uns nicht mehr umfassend nähren und gesund machen. Selbst mit Krankheiten als Folge von „mal bouffe“ lässt sich wiederum Geld verdienen. Quasi ein Perpetuum mobile. Wer Pestizide verkauft, bietet oft auch Pharmaprodukte an.
„Grösser – weiter – mehr“ erzwingt das Weichen
Das Prinzip „Wachsen oder Weichen“ auf die Ernährung und die Landwirtschaft anzuwenden, ist paradox. Ohne Wachstum von Pflanzen hätten wir nichts zu essen. Mit „Wachsen“ ist hier jedoch alles Nicht-Natürliche gemeint. Wachsen tun Besitz, Betriebsgrößen, Transportwege, Inputs an Futtermitteln, Antibiotika-, Dünger- und Pestizideinsatz, Monokulturen, Standardisierungen, Expertenwissen, Kontrollen, Formulare, Anzahl technischer Apparate und Maschinen und der Kapitalbedarf.
Weichen tun viele bäuerliche Betriebe, lokale Käsereien, Metzgereien, Mostereien, ja die lokale Wirtschaft. Die Natur muss ebenfalls weichen: keine Hecken, Bäche, Brachen oder Hochstammbäume. Nur noch sterile Monokulturfelder ohne Beikräuter, Schmetterlinge, Vögel, Insekten. Auch die Regenwürmer weichen aus den Böden ohne organischen Dünger.
Keine Alternativen in Sicht
Die betriebswirtschaftliche Logik steht mit der volkswirtschaftlichen in Konflikt. Jeder Akteur, jede Bäuerin macht, was aus seiner und ihrer Sicht sinnvoll, effizient und rentabel ist. Die Milch mit zwei verschiedenen Lastwägen zu zwei verschiedenen Verarbeitern zu bringen, ist für die Transporteure und die Großmolkereien offensichtlich rentabel. 8.000 Legehennen mit Importfutter zu füttern und den Mist weg zu transportieren, rechnet sich. Unsere ganze Gesellschaft ist so organisiert. Die verschiedenen Funktionen wurden gemäss industrieller und kapitalistischer Logik getrennt. Das erzeugt nicht nur viele Transporte, sondern alle Nachteile solcher Konzentrationsprozesse: Technisierung, Standardisierung, Anonymisierung von Beziehungen, hohe Investitionen in die Hygiene und einen nicht-nachhaltigen Ressourcenverbrauch. Der Import von Futter und somit Stickstoff führt zu einer Überdüngung der Gewässer. Nur, wer über viel Kapital verfügt, hat genügend Marktmacht, um mitzuspielen. Damit weichen viele kleine Produktions- und Verarbeitungsbetriebe und unser Essen wird immer mehr zur standardisierten Ware. Und: Was passiert eigentlich mit der menschlichen Seele, wenn sie von solcher Einfalt umgeben ist, wenn sie sich täglich mit Monokultur beschäftigt?
Problem als Lösung
„Wachsen oder Weichen“ wird als Allheilmittel propagiert. Die Wachstumsfolgen werden mit weiterem Wachstum und weiterem Weichen behandelt. Eine 8.000-Legehennen-„Produktion“ ist rentabler als ein Bauernhof mit grasgefütterten Kühen, freilaufenden Hühnern, Gemüsegarten und Ackerbau. Die Pferdepension ist nochmals rentabler als der 8.000-Legehennen-Betrieb. Folgen wir dieser Logik, dann wird der heute noch effiziente 8.000-Legehennen-Betrieb weichen, denn ein Golfplatz, eine Villa, ein Supermarkt oder eine Tankstelle mit Shop bringen einfach höhere Hektarerträge.
Ohne die Kleinbauern zu romantisieren gibt es in der Landwirtschaft eine Grenze des Wachstums, nicht nur biologisch, sondern auch sozial und ökonomisch. Wer eine zukunftsfähige Landwirtschaft, welche die demokratischen Prinzipien der Ernährungssouveränität und der radikal verstandenen Nachhaltigkeit hochhält, muss sich für mehr Bäuerinnen und Bauern und eine Vielfalt der Höfe einsetzen. Ziel müssen Bauernbetriebe sein, die mit einem minimalen, vorwiegend lokalen Input auskommen. Erst das schafft Resilienz, also eine Robustheit und Anpassungsfähigkeit, welche die Versorgung mit Lebensmitteln sichert.
Monokultur in „Siderswil“
Alles in Siderswil ist gepflegt, aber seltsam leblos. Nur selten fährt ein Bauer im vollklimatisierten Traktor durchs Dorf. Kein Leben in Siderswil, keine Kinder spielen. Man trifft kaum noch Menschen in Gärten oder im Feld an. Die Bauern haben nichts mehr miteinander zu tun, keine gemeinsamen Milchlieferungen und schon gar keine Käsereigenossenschaft verbindet sie. Hier traf ich exemplarisch das Ergebnis unserer Ernährungs- und Agrarpolitik an. Es gibt, wie überhaupt in unserer Gesellschaft, fast nur noch monofunktionale Orte für monofunktionale Menschen, Tiere und Pflanzen. Eine Monokultur als Folge von „Wachsen oder Weichen“. In diesem Denken werden auch Ökologie und Produktion getrennt. In der neuen Agrarpolitik der Schweiz werden die ökologischen Leistungen jenseits der Produktion honoriert. Was auf den ersten Blick Sinn macht, ist gefährlich. Wenn Bauern und Bäuerinnen mit Buntbrachen und Hecken besser verdienen als mit Kartoffeln, dann wird der Weg für den Agrarfreihandel erleichtert. Dem globalen Preisdruck können wir nicht standhalten, wodurch immer mehr Betriebe verschwinden.
Knappheit statt Fülle
Die 8.000 Legehennen kann man höchstens noch als Suppenhuhn essen, sofern sie nicht gar zu Biogas verwertet werden. Die Artgenossen mit männlichem Geschlecht werden kurz nach dem Schlüpfen getötet. Die Wiesen sind auf einen hohen eiweißhaltigen Ertrag getrimmt, was zwangsläufig eine Reduktion der Artenvielfalt mit sich brachte. Die ausgeräumte Landschaft folgt der Logik der Industrieproduktion. Die Käserei folgt ihrer eigenen Logik und stellt mit fremder Milch Käse für anonyme Essende her.
„Wir brauchen einander eigentlich nicht.“ Das schreibt Charles Eisenstein, der Vordenker der Occupy-Bewegung über die Folgen der Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Was früher ohne Geld in der Nachbarschaft selbstverständlich war, muss heute zugekauft werden: Kinderhüten, Musik, Krankenpflege, Tiere hüten, Saatgut, Lebensmittel beschaffen, Reparieren, Blumenarrangements machen, Ställe und Häuser bauen und vieles mehr.
Was früher in Fülle da war, wird heute knapp und erhält einen Preis. Dadurch weichen die sozialen Bedingungen für Nachhaltigkeit. Wir geben dem Geld zu viel Gewicht und meinen, damit sicher zu sein. Wir sind insgeheim überzeugt, jederzeit auf dem Weltmarkt unsere Lebensmittel einkaufen zu können. Die lokalen Netze der Selbstversorgung werden naiv den Profitinteressen geopfert. Die Welt der Knappheit und der geldvermittelten Beziehungen ist kalt und ohne Solidarität. Wir sind auch auf dem Land abhängig geworden, denn die Fähigkeiten zum Selbermachen und zur Kooperation sind gewichen. Aber: Eine andere Welt ist möglich!
Thomas Gröbly,
thomas.groebly@ethik-labor.ch,
www.ethik-labor.ch